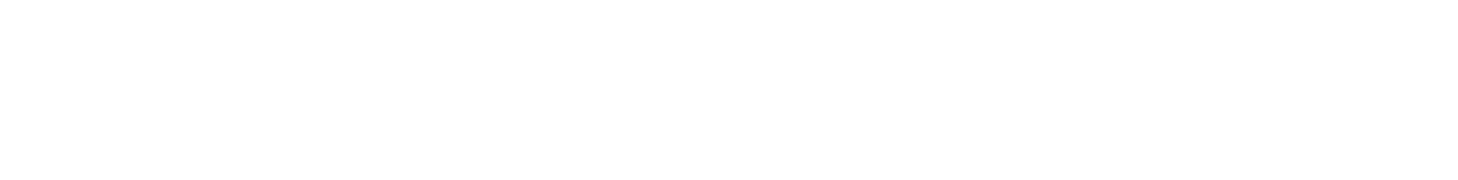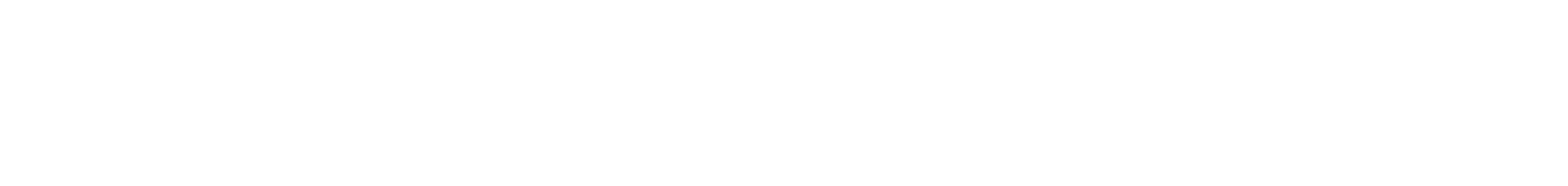Plus und Minus ziehen sich an – das weiß jeder, der schonmal mit Magneten rumgespielt hat. Das Grundprinzip ist auch für die Chemie wichtig, wenngleich hier nicht die magnetische Kraft, sondern die elektrostatische Kraft die wichtigere Rolle spielt.
Plus und Minus ziehen sich an – das weiß jeder, der schonmal mit Magneten rumgespielt hat. Das Grundprinzip ist auch für die Chemie wichtig, wenngleich hier nicht die magnetische Kraft, sondern die elektrostatische Kraft die wichtigere Rolle spielt. In der Chemie sorgt die Anziehung zwischen positiv geladenen und negativ geladenen Teilchen dafür, dass sich Salze bilden. Wir schauen uns am besten ein konkretes Beispiel an, das Du bereits kennengelernt hast im Artikel zur Oktettregel und Edelgaskonfiguration.
In der Chemie sorgt die Anziehung zwischen positiv geladenen und negativ geladenen Teilchen dafür, dass sich Salze bilden. Wir schauen uns am besten ein konkretes Beispiel an, das Du bereits kennengelernt hast im Artikel zur Oktettregel und Edelgaskonfiguration.
 Wir erinnern uns, dass ein Chlor-Atom bereitwillig mit einem Natrium-Atom reagiert, indem es ein Elektron vom Natrium aufnimmt. Geschieht dies, so entstehen zwei geladene Teilchen (zwei Ionen), welche beide die Oktettregel erfüllen. Zum einen das negativ geladene Chlorid-Ion. Negativ geladene Ionen nennt man Anionen. Wohingegen es sich bei dem positiv geladenen Natrium-Ion um ein sogenanntes Kation handelt.
Wir erinnern uns, dass ein Chlor-Atom bereitwillig mit einem Natrium-Atom reagiert, indem es ein Elektron vom Natrium aufnimmt. Geschieht dies, so entstehen zwei geladene Teilchen (zwei Ionen), welche beide die Oktettregel erfüllen. Zum einen das negativ geladene Chlorid-Ion. Negativ geladene Ionen nennt man Anionen. Wohingegen es sich bei dem positiv geladenen Natrium-Ion um ein sogenanntes Kation handelt.Da es sich bei beiden Teilchen um stabile Ionen handelt, passiert chemisch gesehen nichts mehr (Edelgaskonfiguration erreicht). Die Teilchen fliegen noch nicht einmal voneinander weg – da zwischen ihnen die starke elektrostatische Anziehung wirkt, bleiben sie beieinander und ordnen sich in einem Gitter an. Es bildet sich das Salz Natriumchlorid:
 Wenn Du nicht Chemie oder Geowissenschaften studierst, ist die Struktur dieses Gitters nicht relevant. Es geht vielmehr um das Prinzip: Zwischen den Anionen und den Kationen wirkt eine starke Kraft, sodass diese aneinandergebunden sind. Und diese Kraft wird allgemein als Bindung bezeichnet - dieses Bestreben der Teilchen danach, in unmittelbarer Nähe zu bleiben, aufgrund anziehender Kräfte. In diesem Fall ist die Bindung ein Resultat der elektrostatischen Anziehung zweier gegensätzlich geladener Teilchen (Anion und Kation) und wird ionische Bindung genannt. Da die Ladung eines Ions in alle Raumrichtungen gleich wirkt (ungerichtete Kraft), ordnen sich die Ionen somit in einem dreidimensionalen Gitter an.
Wenn Du nicht Chemie oder Geowissenschaften studierst, ist die Struktur dieses Gitters nicht relevant. Es geht vielmehr um das Prinzip: Zwischen den Anionen und den Kationen wirkt eine starke Kraft, sodass diese aneinandergebunden sind. Und diese Kraft wird allgemein als Bindung bezeichnet - dieses Bestreben der Teilchen danach, in unmittelbarer Nähe zu bleiben, aufgrund anziehender Kräfte. In diesem Fall ist die Bindung ein Resultat der elektrostatischen Anziehung zweier gegensätzlich geladener Teilchen (Anion und Kation) und wird ionische Bindung genannt. Da die Ladung eines Ions in alle Raumrichtungen gleich wirkt (ungerichtete Kraft), ordnen sich die Ionen somit in einem dreidimensionalen Gitter an.Die ionische Bindung ist charakteristisch für Salze. In der Umgangssprache ist mit Salz das Kochsalz (Natriumchlorid) gemeint. Allerdings gibt es in der Chemie eine allgemeinere Definition:
Warum ist das so?
Eine ionische Bindung liegt vor, wenn bei der Bindung ein Partner die Elektronen (nahezu) vollständig abgibt, und der andere Partner die Elektronen vollständig aufnimmt, sodass wirklich Ionen vorliegen. Ist dies nicht der Fall, liegt eine (polare) kovalente Bindung vor. Ob das passiert, ist grade von der Elektronegativitätsdifferenz abhängig. Wenn die Differenz sehr hoch ist, behält der elektronegativere Partner die Elektronen nahezu vollständig und es liegen Ionen und somit Salze vor. Ist die Differenz sehr niedrig, liegen keine Ionen vor, da die Elektronen eher geteilt werden.
Metalle wie Natrium haben eine sehr niedrige Elektronegativität, wohingegen Nichtmetalle wie Chlor oder Sauerstoff eine sehr hohe Elektronegativität besitzen. Folglich liegt automatisch eine hohe Elektronegativitätsdifferenz vor, wenn eine Verbindung aus einem Metall und einem Nichtmetall gebildet wird.
 Wir könnten uns also auch zwei andere Elemente raussuchen und das dazugehörige Salz bilden. Nehmen wir mal das Metall Lithium (Li) und das Nichtmetall Schwefel (S). Reagieren sie miteinander entsteht das Salz Lithiumsulfid.
Wir könnten uns also auch zwei andere Elemente raussuchen und das dazugehörige Salz bilden. Nehmen wir mal das Metall Lithium (Li) und das Nichtmetall Schwefel (S). Reagieren sie miteinander entsteht das Salz Lithiumsulfid. Zuerst zum Namen: Du hast vielleicht schon gemerkt, dass sich der Name eines Salzes immer aus dem Namen des Kations und dem des Anions (mit einem -id hintendran) zusammensetzt. Mehr dazu erfährst du in der nächsten Lektion zur Nomenklatur und Summenformel von Salzen (Comming soon).
An diesem Beispiel soll nochmal verdeutlicht werden, warum sich das Salz überhaupt bildet.
Lithium steht in der ersten Gruppe. Es hat ein Elektron in der Valenzschale und hat somit ein hohes Bestreben danach, dieses Elektron abzugeben, um die Edelgaskonfiguration zu erhalten (=volle Valenzschale. In diesem Fall wäre es dann die volle K-Schale, welche nun die Valenzschale ist).
Schwefel steht in der 16. Gruppe bzw. der 6. Hauptgruppe. Ihm fehlen noch zwei Elektronen, damit es durch eine volle Valenzschale die Edelgaskonfiguration erhält. Es muss also noch zwei Elektronen aufnehmen. Da Lithium aber nur ein Elektron abgeben kann, benötigen wir doppelt so viele Lithium-Atome wie Schwefel-Atome, damit sich einmal Lithiumsulfid bilden kann.
 Ein Schwefel-Atom erhält von zwei Kalium-Atomen jeweils ein Elektron. Nun hat jedes Teilchen die Oktett-Regel erfüllt. Das Anion von Schwefel wird Sulfid-Anion genannt und ist zweifach negativ geladen, da es zwei Elektronen mehr in der Hülle hat als Protonen im Kern.
Ein Schwefel-Atom erhält von zwei Kalium-Atomen jeweils ein Elektron. Nun hat jedes Teilchen die Oktett-Regel erfüllt. Das Anion von Schwefel wird Sulfid-Anion genannt und ist zweifach negativ geladen, da es zwei Elektronen mehr in der Hülle hat als Protonen im Kern. Wie Salze (auch von Säuren und Basen) benannt werden, wie die Summenformel bestimmt wird und was es noch für Bindungsarten gibt, erfährst Du in den jeweiligen Lektionen (Comming soon).
Auf einem Blick...
Ionische Bindung & Salze
- Metalle und Nichtmetalle reagieren zu Salzen
- Salze sind Stoffe, welche aus einem Kation und einem Anion aufgebaut sind
- Die gegensätzlich geladenen Ionen werden durch ionische Bindungen zusammengehalten
- Bei der ionischen Bindung handelt es sich um eine elektrostatische Anziehungskraft zwischen Kationen & Anionen
- Kationen und Anionen werden in einem Metallgitter zusammengehalten
Referenzen
1. E. Riedel, H.-J. Meyer in Allgemeine und anorganische Chemie,
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abbildungen selbst angefertigt.