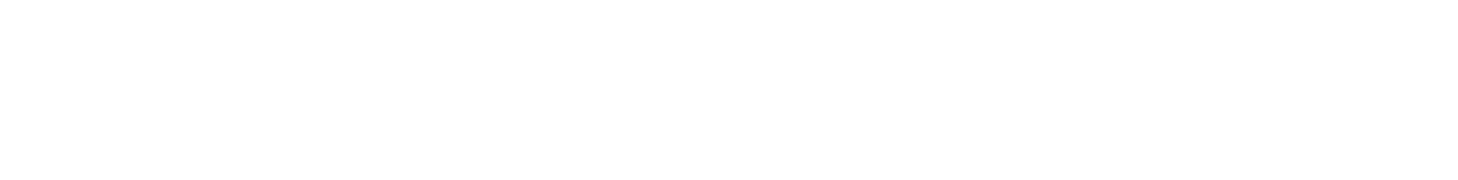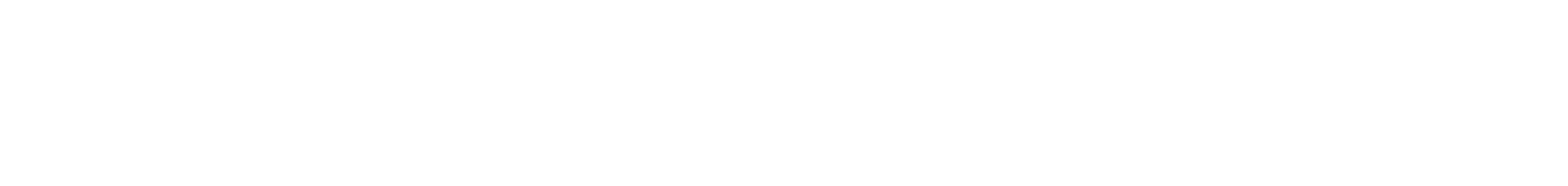Wir wissen aus der letzten Lektion, dass Nicht-Metalle untereinander kovalente Bindungen ausbilden. Sie teilen sich ein bindendes Elektronenpaar, damit sie die Oktett-Regel erfüllen können. Was ich aber bisher verschwiegen hab: Es wird nicht immer fair geteilt. Manche Elemente ziehen in einer kovalenten Bindung mehr an dem bindenden Elektronenpaar als andere. Wie „stark“ ein Element an einer Bindung zieht, lässt sich mit Hilfe der Elektronegativität des Elements beschreiben.
Wir wissen aus der letzten Lektion, dass Nicht-Metalle untereinander kovalente Bindungen ausbilden. Sie teilen sich ein bindendes Elektronenpaar, damit sie die Oktett-Regel erfüllen können. Was ich aber bisher verschwiegen hab: Es wird nicht immer fair geteilt. Manche Elemente ziehen in einer kovalenten Bindung mehr an dem bindenden Elektronenpaar als andere. Wie „stark“ ein Element an einer Bindung zieht, lässt sich mit Hilfe der Elektronegativität des Elements beschreiben.
Was ist die Elektronegativität?
Jedes Element hat eine bestimmte Elektronegativität. Wir schauen uns zur Erklärung mal das Molekül Chlorwasserstoff an. Zwischen Wasserstoff und Chlor liegt eine kovalente Bindung vor. Chlor ist ein sehr elektronegatives Element, Wasserstoff dagegen nicht so sehr. Chlor zieht deshalb viel mehr an den Bindungselektronen. Um das zu auszudrücken, wird manchmal eine solche Schreibweise verwendet:
Zwischen Wasserstoff und Chlor liegt eine kovalente Bindung vor. Chlor ist ein sehr elektronegatives Element, Wasserstoff dagegen nicht so sehr. Chlor zieht deshalb viel mehr an den Bindungselektronen. Um das zu auszudrücken, wird manchmal eine solche Schreibweise verwendet:

 Das ist das Geringste, was Du wissen musst, um die nächsten Abschnitte zu verstehen. Ich empfehle Dir aber, dieses Kapitel noch zu Ende zu lesen.
Das ist das Geringste, was Du wissen musst, um die nächsten Abschnitte zu verstehen. Ich empfehle Dir aber, dieses Kapitel noch zu Ende zu lesen.Trends und Ursachen der Elektronegativität
Schaut man sich die Elektronegativitäten im Periodensystem an, so stellt man folgende Trends fest: Die Elektronegativität (EN) nimmt im Periodensystem von unten nach oben, und von links nach rechts zu. Helium wird aber ausgeklammert, da es keine Verbindungen eingeht, anhand derer die EN bestimmt werden könnte. Fluor ist somit mit einer EN von 3,98 das elektronegativste Element. Danach folgen Sauerstoff und Chlor.
Die Elektronegativität (EN) nimmt im Periodensystem von unten nach oben, und von links nach rechts zu. Helium wird aber ausgeklammert, da es keine Verbindungen eingeht, anhand derer die EN bestimmt werden könnte. Fluor ist somit mit einer EN von 3,98 das elektronegativste Element. Danach folgen Sauerstoff und Chlor.Um den Trend zu verstehen, schauen wir uns an, woraus die Elektronegativität resultiert. Es lässt sich sagen, dass ein elektronegatives Element seine Elektronen (und damit auch Bindungselektronen) sehr stark an sich zieht. Der „Zug“ kommt vom positiv geladenen Kern des Elements, welcher die negativ geladenen Elektronen anzieht. Als Fachausdruck wird hier von der effektiven Kernladung gesprochen, welches beeinflusst, wie stark die (Valenz-)Elektronen am Atom gebunden sind. Ein Element hat eine hohe effektive Kernladung (und damit eher eine höhere Elektronegativität), wenn
- Die Kernladung höher ist , sprich, mehr Protonen im Kern vorliegen
- Weniger Elektronen die positive Ladung des Kerns abschirmen
Die zweite Bedingung ist der Grund dafür, dass die EN von unten nach oben im PSE zunimmt bzw. von oben nach unten abnimmt. Denn, je mehr innere Schalen es gibt, welche mit Elektronen besetzt sind, desto mehr schirmen sie die positive Ladung des Kerns ab. Die Valenzelektronen merken also weniger von der Anziehung des Kerns.
 Wenn das Atom aber über weniger Elektronen verfügt, gibt es auch weniger Elektronen, welche die positive Ladung abschirmen. Die effektive Kernladung steigt, wodurch die Valenzelektronen wieder mehr von der Anziehung des Kerns merken und somit fester am Atom gebunden sind.
Wenn das Atom aber über weniger Elektronen verfügt, gibt es auch weniger Elektronen, welche die positive Ladung abschirmen. Die effektive Kernladung steigt, wodurch die Valenzelektronen wieder mehr von der Anziehung des Kerns merken und somit fester am Atom gebunden sind.
 Die EN nimmt also von unten nach oben im PSE zu, da die Atome von unten nach oben kleiner werden & über weniger Elektronen verfügen, weshalb die Kernladung schlechter abgeschirmt wird und die Valenzelektronen somit fester am Atom gebunden sind.
Die EN nimmt also von unten nach oben im PSE zu, da die Atome von unten nach oben kleiner werden & über weniger Elektronen verfügen, weshalb die Kernladung schlechter abgeschirmt wird und die Valenzelektronen somit fester am Atom gebunden sind.Manche von Euch haben jetzt aber bestimmt einen Widerspruch erkannt. Wenn die EN mit steigender Elektronenzahl abnimmt, warum nimmt die EN dann innerhalb einer Periode trotzdem zu? Dort kommen doch auch immer mehr Elektronen hinzu?
Die Antwort liegt darin, dass innerhalb einer Periode immer nur eine Schale befüllt wird. Die Elektronen haben also alle denselben Abstand zum Kern. Sie können die positive Ladung nicht gut gegenseitig abschirmen, denn das machen hauptsächlich die inneren (vollbesetzten) Schalen. Die Kernladung steigt aber innerhalb einer Periode immer weiter.
Da also der Kern innerhalb einer Periode immer stärker an den Elektronen zieht, die Valenzelektronen diese aber nicht voneinander abschirmen können, werden sie mit steigender Ordnungszahl immer stärker vom Kern angezogen. Erst wenn wir die Schale voll besetzt haben und dann zur nächsten Periode kommen, werden die Elektronen weiter vom Kern weg besetzt, sodass die Elektronen aus der Schale davor diese gut vom Kern abschirmen können.
Was bedeutet dies für kovalente Bindungen?
Elektronegative Elemente ziehen ihre Valenzelektronen stark an und in einer kovalenten Bindung ziehen sie dadurch auch mehr am bindenden Elektronenpaar. In welchem Ausmaß dies bei einer Bindung passiert, lässt sich durch die Elektronegativitätsdifferenz ermitteln. Bei HCl liegt mit einer Elektronegativitätsdifferenz von 0,94 eine recht große Differenz vor. Die Elektronen werden stark an das elektronegativere Chlor gezogen, weshalb es partiell negativ geladen ist. Das Wasserstoff-Atom ist hingegen partiell positiv geladen, da die Elektronen zum Chlor hin verschoben werden und dem H nicht vollständig zur Verfügung stehen. Das Ergebnis ist eine polare Bindung.
Bei HCl liegt mit einer Elektronegativitätsdifferenz von 0,94 eine recht große Differenz vor. Die Elektronen werden stark an das elektronegativere Chlor gezogen, weshalb es partiell negativ geladen ist. Das Wasserstoff-Atom ist hingegen partiell positiv geladen, da die Elektronen zum Chlor hin verschoben werden und dem H nicht vollständig zur Verfügung stehen. Das Ergebnis ist eine polare Bindung.
 Die Partialladungen werden mit einem ∂ gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um „richtige“ (Formal-)Ladungen, wie bei Anionen und Kationen. Es liegt lediglich eine sogenannte vor, was nichts anderes bedeutet, als dass durch die ungleiche Verteilung der Elektronen ein Bindungspartner mehr von den Bindungselektronen hat (negativ polarisiert) als der andere (positiv polarisiert).
Wir schauen uns jetzt mal Bromwasserstoff auf dieselbe Weise an.
Die Partialladungen werden mit einem ∂ gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um „richtige“ (Formal-)Ladungen, wie bei Anionen und Kationen. Es liegt lediglich eine sogenannte vor, was nichts anderes bedeutet, als dass durch die ungleiche Verteilung der Elektronen ein Bindungspartner mehr von den Bindungselektronen hat (negativ polarisiert) als der andere (positiv polarisiert).
Wir schauen uns jetzt mal Bromwasserstoff auf dieselbe Weise an.
 Die Elektronegativitätsdifferenz beträgt hier nur 0.76. Es liegt auch eine polare Bindung vor, allerdings weniger polar als bei HCl. Polarisierungen können also unterschiedlich stark sein. Wir gehen die gesamten Richtwerte (!) mal durch:
Die Elektronegativitätsdifferenz beträgt hier nur 0.76. Es liegt auch eine polare Bindung vor, allerdings weniger polar als bei HCl. Polarisierungen können also unterschiedlich stark sein. Wir gehen die gesamten Richtwerte (!) mal durch:
- Wenn die Elektronegativitätsdifferenz 0 beträgt (wie bei Cl2 bspw.), dann liegt eine vollständig kovalente Bindung vor. Die Elektronen werden gleichermaßen geteilt und es liegt keine Polarisierung vor (unpolar kovalent). Bei Differenzen bis 0,5 wird auch noch vereinfacht eine unpolar kovalente Bindung angenommen
- • Liegt die Differenz zwischen 0,5 und ca. 1,7, dann liegt eine polar kovalente Bindung vor – die Elektronen werden von dem elektronegativeren Bindungspartner stark angezogen.
- Liegt die Differenz über 1,7, so wird von einer ionischen Bindung ausgegangen – die Elektronen werden von einem Partner so stark angezogen, dass sie (nahezu) vollständig zum elektronegativeren Element übergehen.
Auf einem Blick...
Elektronegativität
- Jedes Element verfügt über eine bestimmte Elektronegativität, welche am PSE abgelesen werden kann
- Die EN hängt von der Kernladung und der Anzahl an (abschirmenden) Elektronen ab
- Die EN nimmt im PSE von unten nach oben, und von links nach rechts zu. Fluor besitzt somit die höchste EN.
- Liegt in einer kovalenten Bindung eine EN-Differenz (von über 0,5) vor, so zieht das elektronegativere Element die Elektronen mehr an sich und wird partiell negativ geladen – es liegt eine polar kovalente Bindung vor
- Bei einer EN-Differenz von über 1,7 liegt (vereinfacht) eine ionische Bindung vor
Referenzen
1. E. Riedel, H.-J. Meyer in Allgemeine und anorganische Chemie,
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abbildungen selbst angefertigt.