 Wenn du weißt, in welches Orbital ein Elektron kommt, wenn man das PSE entlanggeht, dann hast Du auch alles, was du brauchst, um die Elektronenkonfiguration zu bestimmen.
Wenn du weißt, in welches Orbital ein Elektron kommt, wenn man das PSE entlanggeht, dann hast Du auch alles, was du brauchst, um die Elektronenkonfiguration zu bestimmen.
Was ist eine Elektronenkonfiguration?
Eine Elektronenkonfiguration wird wie folgt angegeben: Sie sagt aus, welche Orbitale wie befüllt sind bei einem bestimmten Element. Im Prinzip gibt es immer nur drei Informationen pro Block:
Sie sagt aus, welche Orbitale wie befüllt sind bei einem bestimmten Element. Im Prinzip gibt es immer nur drei Informationen pro Block:
 Wir listen also lediglich auf. Im Gegensatz zum Aufbau-Prinzip machen wir uns aber nicht nur Gedanken darüber, in welches Orbital das Elektron bei einem bestimmten Feld kommt, sondern auch darüber, in welchen Orbitalen sich alle anderen Elektronen befinden, die vorher kamen. Wir holen uns nochmal das nützliche PSE mit den Blöcken zur Hand:
Wir listen also lediglich auf. Im Gegensatz zum Aufbau-Prinzip machen wir uns aber nicht nur Gedanken darüber, in welches Orbital das Elektron bei einem bestimmten Feld kommt, sondern auch darüber, in welchen Orbitalen sich alle anderen Elektronen befinden, die vorher kamen. Wir holen uns nochmal das nützliche PSE mit den Blöcken zur Hand:
 Wir suchen uns jetzt als Beispiel Fluor (F) heraus. Es befindet sich hier:
Wir suchen uns jetzt als Beispiel Fluor (F) heraus. Es befindet sich hier:
 Wir merken uns die Stelle, und gehen nochmal das PSE von Wasserstoff beginnend durch, bis wir zu Fluor gelangen. Wir notieren uns jeden vollständig besetzten Block auf dem Weg dorthin.
Wir merken uns die Stelle, und gehen nochmal das PSE von Wasserstoff beginnend durch, bis wir zu Fluor gelangen. Wir notieren uns jeden vollständig besetzten Block auf dem Weg dorthin.Zuerst kommt der 1s-Block. Dieser ist vollständig besetzt, und zwar mit 2 Elektronen. Also schreiben wir auf:
Nimm dir jetzt mal ein Blatt Papier, und probiere die Elektronenkonfiguration von Silizium (Si) zu bestimmen!
Lösung
 Damit man nicht beim Wasserstoff beginnen muss, ersetzen wir alles, was vor der dritten Periode kommt, einfach durch [Ne]. Den Teil, den wir durch [Ne] ersetzt haben, ist nämlich gerade die Elektronenkonfiguration von Neon (gerne selbst mal überprüfen).
Damit man nicht beim Wasserstoff beginnen muss, ersetzen wir alles, was vor der dritten Periode kommt, einfach durch [Ne]. Den Teil, den wir durch [Ne] ersetzt haben, ist nämlich gerade die Elektronenkonfiguration von Neon (gerne selbst mal überprüfen).Und das können wir (bis auf bei der ersten Periode) immer machen. Wenn wir bspw. von Calcium (Ca) die Elektronenkonfiguration bestimmen wollen, müssen wir nicht wieder bei Wasserstoff beginnen und den gesamten Weg aufschreiben. Wir schrieben einfach das Element, welches in der Periode darüber ganz rechts im Periodensystem steht (also ein Edelgas) in eckige Klammern – in diesem Fall wäre es Argon, also schreiben wir
Lösung
Lösung
Beachte: Man könnte die Elektronenkonfiguration auch so schreiben: [Ar] 3d10 4s2 4p3
Also numerisch (nach Hauptquantenzahl) geordnet, und nicht nach der Energie bzw. Abfolge im PSE. Im Idealfall steht in der Klausur, was gefordert ist. Am besten informierst Du dich vorher.
Anionen und Kationen
Was auch gerne gefragt wird, ist die Elektronenkonfiguration von Anionen und Kationen. Das ist aber nicht sonderlich schwer. Wenn nach der Elektronenkonfiguration eines Chlorid-Ions (Cl-) gefragt ist, gehst du wie folgt vor:- Bestimme die Elektronenkonfiguration des Elements (ohne Ladung etc.)
- Füge noch ein Elektron hinzu (oder zieh eins ab, wenn nach einem Kation gefragt ist)
oder einfach
[Ar]
 Du musst hier zwei Felder nach rechts gehen, weil die Ladung vom Sulfid-Ion minus Zwei beträgt. Es hat ja zwei Elektronen „zu viel“.
Für Na+ wäre es:
Du musst hier zwei Felder nach rechts gehen, weil die Ladung vom Sulfid-Ion minus Zwei beträgt. Es hat ja zwei Elektronen „zu viel“.
Für Na+ wäre es:
 Du musst ein Feld nach links gehen, weil das Natrium-Kation einfach positiv geladen ist. Es hat ein Elektron weniger als elementares Natrium.
Du musst ein Feld nach links gehen, weil das Natrium-Kation einfach positiv geladen ist. Es hat ein Elektron weniger als elementares Natrium.
Schon wieder Ausnahmen…
Es könnte sein, dass die paar Ausnahmen, die es gibt, für Dich als Nebenfächler*in irrelevant sind. Ich habe aber auch schon gesehen, dass diese Ausnahmen in der Klausur gefragt wurden. An sich sind sie nicht schwer.Aus dem Artikel zum Orbitalmodell (Comming soon) wissen wir, dass in jedes Orbital zwei Elektronen passen. Da es nur ein s-Orbital gibt in jeder Periode, passen bspw. in den 4s-Block zwei Elektronen. In den 3d-Block hingegen, passen ganze 10 Elektronen. Aus der Oktettregel weißt du, dass abgeschlossene Schalen (also wie bei den Edelgasen) stabil sind. Es gibt aber noch eine Erweiterung dieser Regel:
Die tatsächliche Elektronenkonfiguration lautet daher:
Auf einem Blick...
Elektronegativität
- Mit der Elektronenkonfiguration listet man in Blöcken auf, in welchen Orbitalen sich wie viele Elektronen eines Elements befinden
- Zur Bestimmung folgt man dem Aufbau-Prinzip
- Man kann mit Hilfe des Edelgases aus der Periode über dem gesuchten Element abkürzen.
Referenzen
1. E. Riedel, H.-J. Meyer in Allgemeine und anorganische Chemie,
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abbildungen selbst angefertigt.
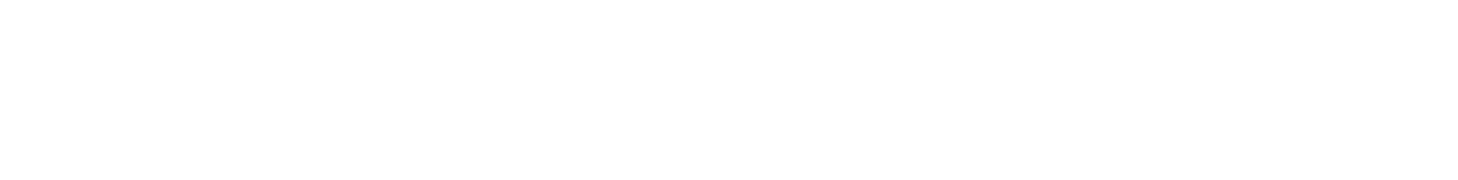
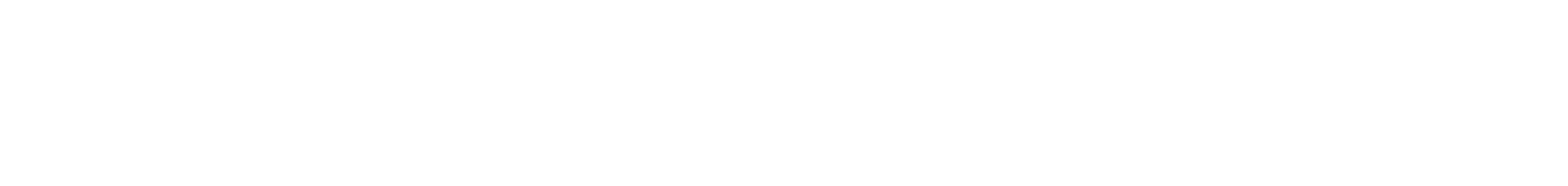
laborhelfer.de