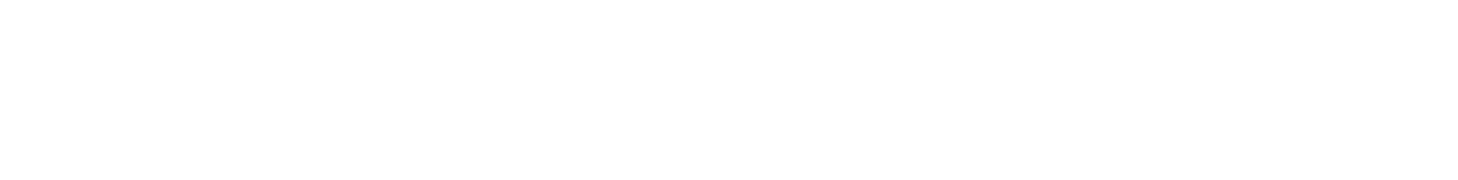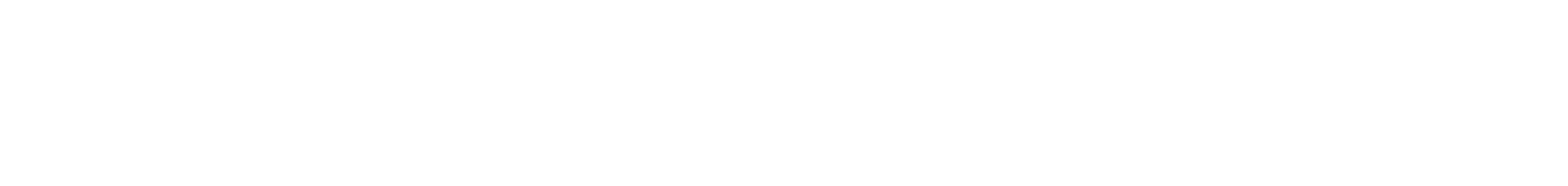Säulenchromatographien sind das täglich Brot in der organischen Synthesechemie. Wenn man einmal den Ablauf verinnerlicht hat, kriegt man sie auch schnell hin. Doch grade am Anfang des Studiums werden die einzelnen Schritte schnell vergessen.
Im Folgenden erkläre ich Dir Schritt für Schritt, wie man eine Säulenchromatographie aufbaut und durchführt. Du kannst Dir entweder die ausführliche Erklärung durchlesen, damit Du die Schritte besser verstehst und sie Dir so leichter merken kannst.
Säulenchromatographien sind das täglich Brot in der organischen Synthesechemie. Wenn man einmal den Ablauf verinnerlicht hat, kriegt man sie auch schnell hin. Doch grade am Anfang des Studiums werden die einzelnen Schritte schnell vergessen.
Im Folgenden erkläre ich Dir Schritt für Schritt, wie man eine Säulenchromatographie aufbaut und durchführt. Du kannst Dir entweder die ausführliche Erklärung durchlesen, damit Du die Schritte besser verstehst und sie Dir so leichter merken kannst.Rohprodukt analysieren
Damit wir eine Säule aufbauen können, brauchen wir zwei wichtige Informationen: Wie muss das Laufmittel zusammengesetzt sein und wie viel Silicagel (stationäre Phase) benötigen wir?1. Laufmittelverhältnis bestimmen
Das Laufmittel ist in den meisten Fällen ein Gemisch aus Cyclohexan und Ethylacetat. Nun gilt es herauszufinden, in welchem Mischungsverhältnis wir das Laufmittel ansetzen müssen. Das machen wir anhand einer Dünnschichtchromatographie (DC). Unser Ziel ist es, dass der Rf-Wert des Produkts bei ca. 0,3 liegt. Idealerweise darunter, aber nicht zu viel. Sonst dauert die Säule zu lange.Was ist der Rf-Wert?

Warum muss der Rf-Wert bei 0,3 liegen?
2. Benötigte Trennleistung ermitteln
Jetzt schauen wir uns die letzte DC (, wo der Rf-Wert bei ca. 0,3 lag) nochmal an. Wir sehen nicht nur unseren Produkt-Spot, sondern auch die Spots von Nebenprodukten oder vom Edukt. Es gibt nun zwei Fälle: Sehr nah am Produktspot befinden sich auch weitere Spots. In diesem Fall benötigen wir eine Säule mit hoher Trennleistung. Das heißt, wir brauchen viel Silicagel bei der Säule später. Darauf kommen wir noch zurück.
Es gibt nun zwei Fälle: Sehr nah am Produktspot befinden sich auch weitere Spots. In diesem Fall benötigen wir eine Säule mit hoher Trennleistung. Das heißt, wir brauchen viel Silicagel bei der Säule später. Darauf kommen wir noch zurück.

Im zweiten Fall liegt sehr viel Platz zwischen Produkt-Spot und den anderen Spots. Die Spots sind also von Natur aus leicht auftrennbar und wir benötigen keine so hohe Trennleistung. Hier genügt weniger Silica in der Säule.
 Wir wissen jetzt, welches Laufmittelverhältnis und wie viel Silica wir für die Säule benötigen. Als nächstes bauen wir die Säule auf.
Wir wissen jetzt, welches Laufmittelverhältnis und wie viel Silica wir für die Säule benötigen. Als nächstes bauen wir die Säule auf.
Die Säule aufbauen und vorbereiten
Die Chromatographiesäule spannt man mit zwei Klammern auf: Eine Klammer am Schliff und eine zweite Klammer locker (!) auf mittlerer Höhe. Die Säule sollte von allen Richtungen aus betrachtet gerade sein. Wenn sie steht, packen wir ein kleines Becherglas o.Ä. unter den geschlossenen Hahn. Nun können wir auch ein paar weitere Kleinigkeiten vorbereiten:- Schnappgläser aufstellen und ggf. nummerieren
- Größere Menge Laufmittel ansetzen (~1 L für den Anfang, je nach Größenkala mehr)
- Rohprodukt in so wenig (!) Laufmittel, wie möglich lösen, Gefäß verschließen und bei Seite stellen

Was, wenn sich das Produkt nicht gut genug im Laufmittel löst?
- Ein wenig DCM hinzugeben. Ein wenig Dichlormethan kann die Löslichkeit im Laufmittel drastisch erhöhen. Hier reichen manchmal schon wenige Milliliter.
- Auf Silica aufziehen. Hierfür lösen wir das Rohprodukt in einem Rundkolben in einem Lösungsmittel, in welchem es sich leicht lösen lässt. Dann geben wir in den Rundkolben so viel Silica, dass die gesamte Flüssigkeit bedeckt ist. Wir erhalten eine festgepappte Masse. Jetzt ziehen wir am Rotationsverdampfer das Lösungsmittel wieder ab. Übrig bleibt das trockene Silica, in welchem sich immer noch das Rohprodukt befindet. Das Silica-Gemisch geben wir später auf die bepackte Säule (nach Schritt 3).
3. Die Säule bepacken
Mit einem Feststofftrichter geben wir als nächstes das Silica in die Säule. Mindestens bis zur Hälfte, maximal bis unter den Schliff kann man Silica hineingeben. Wie viel genau, schätzen wir anhand unserer Erkenntnis aus Schritt 2 ab. Je höher die benötigte Trennleistung, desto mehr Silica kommt in die Säule. Dann wird das Silica aus der Säule in ein großes Becherglas oder in einen Erlenmeyerkolben geschüttet. Wir schlämmen das Silica nun mit dem Laufmittel auf, sprich, wir geben das Laufmittel hinzu und verrühren das Ganze. Die Konsistenz sollte so wie die von Rübenkraut oder Kleister sein. Tendenziell aber lieber zu flüssig. Denn wenn das Gel zu dickflüssig ist, bilden sich Blasen in der Säule. Jetzt geben wir das aufgeschlämmte Silica wieder in die Säule. Hierfür am besten einen Trichter verwenden und das Silica langsam am Rand hinunterlaufen lassen, damit keine Blasen entstehen. Sobald alles drin ist, einmal überprüfen, ob sich Blasen gebildet haben. Wenn ja, kann man diese manchmal loswerden, indem man mit einem Korkring sanft (!) gegen die Säule klopft. Als nächstes müssen wir das überschüssige Laufmittel entfernen. Das Silica setzt sich bereits von allein etwas ab und darüber bleibt eine Schicht Laufmittel. Bevor wir das tun, befreien wir die Innenseite der Säule und vor allem den Schliff von angehafteten Silica, indem wir mit einer Pasteur-Pipette den Schliff und die Innenwand mit Laufmittel abspülen.
Als nächstes müssen wir das überschüssige Laufmittel entfernen. Das Silica setzt sich bereits von allein etwas ab und darüber bleibt eine Schicht Laufmittel. Bevor wir das tun, befreien wir die Innenseite der Säule und vor allem den Schliff von angehafteten Silica, indem wir mit einer Pasteur-Pipette den Schliff und die Innenwand mit Laufmittel abspülen.Jetzt öffnen wir den Hahn (Becherglas sollte darunter stehen) und Pumpen mit einer Handpumpe das überschüssige Laufmittel hinunter. Aber Achtung: Das Silica darf niemals wieder trocken werden. Deshalb nicht zu schnell pumpen. Wir lassen jetzt so viel Laufmittel ab, bis noch ca. einen Zeigefinger hoch Laufmittel über der Silicaschicht liegt. Das restliche Laufmittel lassen wir jetzt nicht mehr mit der Pumpe, sondern nur noch über die Schwerkraft abfließen. Es soll so wenig Laufmittel wie möglich über der Silicaschicht am Ende liegen. Hierfür kann man sanft gegen die Säule klopfen, sodass auf der Oberfläche des Laufmittels kleine Wellen entstehen. Spätestens, wenn sich keine Wellen mehr bilden, muss der Hahn wieder geschlossen werden. Außerdem muss man hier einkalkulieren, dass die Laufmittelfront noch ein kleines bisschen sinkt, nachdem der Hahn geschlossen wurde.
 Jetzt haben wir die Säule erfolgreich bepackt. Wenn ihr jetzt für den nächsten Schritt noch Zeit braucht, unbedingt noch daran denken einen Plastikstopfen auf die Säule zu tun, damit das Laufmittel nicht evaporisiert und das Silica trocken wird.
Jetzt haben wir die Säule erfolgreich bepackt. Wenn ihr jetzt für den nächsten Schritt noch Zeit braucht, unbedingt noch daran denken einen Plastikstopfen auf die Säule zu tun, damit das Laufmittel nicht evaporisiert und das Silica trocken wird.
4. Das Rohprodukt auftragen
Jetzt holen wir eine lange Pasteur-Pipette und nehmen damit das im Laufmittel gelöste Rohprodukt auf. Je weniger Laufmittel ihr zum Lösen des Rohprodukts und evtl. zum Nachspülen braucht, desto besser die Auftrennung am Ende. Dann geht man mit der Pipette in die Säule und trägt das Rohprodukt ganz knapp über der Silica-Schicht auf. Hierbei soll das Produkt möglichst gleichmäßig verteilt werden. Deshalb in kreisförmigen Bewegungen das Produkt am Rand entlanglaufen lassen. Wenn man zu feste drückt, kann der Strahl aus der Pipette das Silica wieder aufschlämmen. Das muss auf jeden Fall vermieden werden.Ist alles aufgetragen, pumpen wir das produkthaltige Laufmittel wieder so weit hinunter, dass erneut nur noch eine ganz dünne Schicht Laufmittel über dem Silica liegt. Am besten auch hier kurz vor Schluss nur mit der Schwerkraft arbeiten.
5. Laufmittel hineingeben
Da unser Produkt sich nun im Silcia befindet, können wir als nächstes das Laufmittel dazugeben. Wir fangen an, indem wir erneut mit einer langen Pasteur-Pipette das reine Laufmittel vorsichtig und in kreisenden Bewegungen an der Innenseite der Säule herunterlaufen lassen. Das Silica darf auch hier nicht aufgeschlämmt werden. Das machen wir so lange, bis 5-10 cm Laufmittel über der Silciaschicht liegen. Jetzt kann man mit einem Trichter vorsichtig weiter Laufmittel hinzugeben, bis die Säule bis unter den Schliff befüllt ist. Wenn ihr eine Säulenkugel für zusätzliches Volumen habt, könnt ihr die Kugel mit einer Druckklemme festklammern und diese dann auch befüllen.[1]
Durchführen der Säulenchromatographie
Jetzt stellen wir den ersten Schnappi unter den Hahn und Klammern die Handpumpe an die Säule bzw. die Säulenkugel.6. Sammeln der Fraktionen
Wir öffnen den Hahn und pumpen das Laufmittel in den Schnappi. Wenn dieser halb bis dreiviertel voll ist, wird der Schnappi gewechselt. Wenn das Laufmittel knapp wird, muss unbedingt neues nachgekippt werden, bevor das Silica oben trocken wird. Und das machen wir erstmal für 10-15 Fraktionen.
7. Analysieren der Fraktionen
Nach genügend Fraktionen (10-15) stoppen wir kurz die Säule, indem wir die Pumpe entfernen und den Hahn schließen. Wir machen jetzt eine oder zwei DC´s, in welcher wir immer eine Probe der einzelnen Fraktionen auftüpfeln. Nummerieren nicht vergessen. Als Laufmittel für die DC kann man entweder das Laufmittel verwenden, welches wir für die Säule verwenden, oder ein polareres. Es ist nur wichtig, dass man die Spots gut genug voneinander trennt auf der DC.Wenn die DC fertig ist, färben wir sie an oder wir schauen sie uns unter UV-Licht an. Oft sieht man für die ersten Fraktionen keine Spots. Wenn dies der Fall ist, müssen wir mehr Fraktionen sammeln und auch diese via DC analysieren.
Irgendwann jedoch werdet ihr auf der DC einen Spot ab einer bestimmten Fraktion sehen. Eure DC könnte dann so aussehen:
 In diesem Beispiel erhalten wir 2 Fraktionen mit einem Punkt weit oben auf der DC. Dann kommt erstmal nichts und dann finden wir zwei Spots weiter unten bei späteren Fraktionen, wobei eine Fraktion mit auftritt, bei welcher beide Spots zu finden sind.
In diesem Beispiel erhalten wir 2 Fraktionen mit einem Punkt weit oben auf der DC. Dann kommt erstmal nichts und dann finden wir zwei Spots weiter unten bei späteren Fraktionen, wobei eine Fraktion mit auftritt, bei welcher beide Spots zu finden sind.Jetzt habt ihr genau das erreicht, was ihr wolltet: Ihr habt die einzelnen Stoffe aus dem Rohprodukt aufgetrennt. Wir vergleichen mit der DC des Rohprodukts:
 Wie Du siehst, sieht man genau dieselben Spots wie auf der DC des Rohprodukts, aber in unterschiedliche Fraktionen aufgeteilt!
Wie Du siehst, sieht man genau dieselben Spots wie auf der DC des Rohprodukts, aber in unterschiedliche Fraktionen aufgeteilt! Da wir wissen sollten, welcher Spot zu unserem Produkt gehört, wissen wir jetzt, in welchen Fraktionen sich unser Produkt befindet.
Woher weiß ich, welcher Spot mein Produkt-Spot ist?
Wenn mehrere Spots vorliegen, muss man sich das entweder anhand der Intensitäten bei den Reaktionskontrollen (Intensität das Produkts nimmt im Laufe der Reaktion zu) und des zu erwartenden Laufverhaltens erschließen. Oder man muss von jeder Reinfraktion ein NMR-Spektrum messen, um anhand dessen die Fraktionen mit Produkt zu ermitteln.
Die Fraktionen vereinen
Jede Fraktion, welche auf der DC nur einen Spot aufweist, ist eine Reinfraktion mit nur einem Stoff drin. Jede Fraktion, welche zwei oder mehr Spots aufweist, ist eine Mischfraktion. Mischfraktionen sind blöd, weil hier die Auftrennung nicht gut genug war und wir aus ihnen nicht unser reines Produkt erhalten können. Man möchte deshalb im Idealfall keine Mischfraktionen haben. Dies kann man mit einer höheren Trennleistung und/ oder noch unpolareren Laufmittel erreichen.Wir wollen jetzt alle Fraktionen zusammenkippen, welche Reinfraktionen unseres Produkts sind. Welche Fraktionen das sind, ermitteln wir anhand der DC´s der Säulenchromatographie.
 Da wir wissen, dass der zweite Spot von unten (hier rot) unser Produkt ist, können wir jetzt die Fraktionen 7-9 zusammenkippen. Die Fraktion 10 enthält zwar auch unser Produkt, ist aber eine Mischfraktion. Wenn wir sie hinzugeben würden, würden wir nur unser Produkt verunreinigen.
Da wir wissen, dass der zweite Spot von unten (hier rot) unser Produkt ist, können wir jetzt die Fraktionen 7-9 zusammenkippen. Die Fraktion 10 enthält zwar auch unser Produkt, ist aber eine Mischfraktion. Wenn wir sie hinzugeben würden, würden wir nur unser Produkt verunreinigen. Die Fraktionen vereinigen wir in einem Rundkolben und entfernen das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer (Kolben vorher wiegen, damit die Ausbeute bestimmt werden kann). Nun noch via NMR-Spektroskopie prüfen, ob das Produkt auch wirklich erhalten wurde und wir sind fertig![1]
Tipps & Tricks
Wie lässt sich die Dauer einer Säulenchromatographie verringern?
- So wenig Vorlauf nehmen, dass auf jeden Fall noch kein Produkt hinunterkommen kann
- Ausrechnen wie viel Vorlauf zu erwarten ist
Dann packst du das trockene Silica in die Säule und kippst es dann wie gewohnt in ein Becherglas zum Aufschlämmen. Jetzt nimmst du zum Aufschlämmen das Laufmittel aus dem Messzylinder. Fülle das aufgeschlämmte Silica in die Säule und stelle ein leeres Becherglas unter den Hahn. Jetzt pumpst du das Laufmittel wie gewohnt herunter, bis es knapp über dem Silica steht. Das Laufmittel aus dem Becherglas kippst du jetzt wieder in den Messzylinder. Jetzt hast du im Messzylinder bspw. nur noch 300 mL. Die Differenz, also 200 mL, ist die Menge an Laufmittel in deiner Säule. Das heißt, um deine Säule einmal durchzuspülen, benötigst du 200 mL.
Jetzt kann man mit Hilfe des Rf-Werts berechnen, nach wie viel Milliliter des Laufmittels wir das Produkt grob erwarten. Du benötigst folgende Formel:
Wenn man es also eilig hat, kann man diese Methode zur besseren Abschätzung des Vorlaufs verwenden.
Die Auftrennung ist trotz Rf≤0,3 sehr schlecht
- Langsamer säulen. Wenn das Laufmittel zu schnell durch die Säule gepumpt wird, kann sich das Gleichgewicht der Moleküle zwischen mobiler und stationärer Phase nicht ausreichend einstellen. Im Notfall kann man die ersten Fraktionen auch nur über die Schwerkraft befüllen.
- Mehr Silica in die Säule packen.
- Ein unpolareres Laufmittel verwenden.
- Eine größere Säule verwenden. Wenn der Durchmesser der Säule zu klein ist, bzw. die aufgetragene Menge an Produkt zu hoch, so kann die Säule überladen werden.[1]
Was tun, wenn die Säule immer reißt
- Es entsteht Gas. Manche Stoffe sind instabil auf Silica und decarboxylieren bspw. Das hierbei entstandene Gas sorgt dafür, dass die Säule reißt. Außerdem kann es bei hohen Temperaturen im Labor dazu kommen, dass ein wenig Laufmittel siedet und so zum Reißen der Säule führt. Dies ist vor allem der Fall, wenn man mit n-Pentan o.Ä. säult.
- Es wird zu schnell gesäult. Wenn mehr Laufmittel herausgedrückt wird, als von oben nachfließen kann, reißt die Säule von unter. In diesem Fall das Tempo der Säule erniedrigen.[1]
- Das Silica wurde nicht homogen genug aufgeschlämmt.
Was tun, wenn die Säule immer Blasen hat?
Außerdem hilft oft folgendes: Bevor man das aufgeschlämmte Silica in die Säule gibt, nimmt man wenige Milliliter des Laufmittels und gibt es in die leere Säule. Dann öffnet man den Hahn, sodass ein paar Tropfen hinaustropfen. Dann schließt man den Hahn und packt das aufgeschlämmte Silica hinein. Auf diesem Weg wird Luft aus dem Glasfilter am Boden der Säule verdrängt.
Mein Rohprodukt löst sich nicht im Laufmittel
- Ein wenig DCM hinzugeben. Ein wenig Dichlormethan kann die Löslichkeit im Laufmittel drastisch erhöhen. Hier reichen manchmal schon wenige Milliliter.
- Auf Silica aufziehen. Hierfür lösen wir das Rohprodukt in einem Rundkolben in einem Lösungsmittel, in welchem es sich leicht lösen lässt. Dann geben wir in den Rundkolben so viel Silica, dass die gesamte Flüssigkeit bedeckt ist. Wir erhalten eine festgepappte Masse. Jetzt ziehen wir am Rotationsverdampfer das Lösungsmittel wieder ab. Übrig bleibt das trockene Silica. Das Silica-Gemisch geben wir später auf die bepackte Säule (nach Schritt 3).[1]
Mein Stoff läuft nicht auf der Säule
Mein Stoff geht auf der Säule kaputt
Mein Stoff hat einen langen Schweif auf der DC und lässt sich auf der Säule nicht gut auftrennen
Referenzen
1. Hünig, Märkl, Kreitmeier, Ledermann, Sauer, Podlech in Arbeitsmethoden in der organischen Chemie, Vol. 3, Lehmanns Medias, Berlin, 2014.
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abbildungen selbst angefertigt.