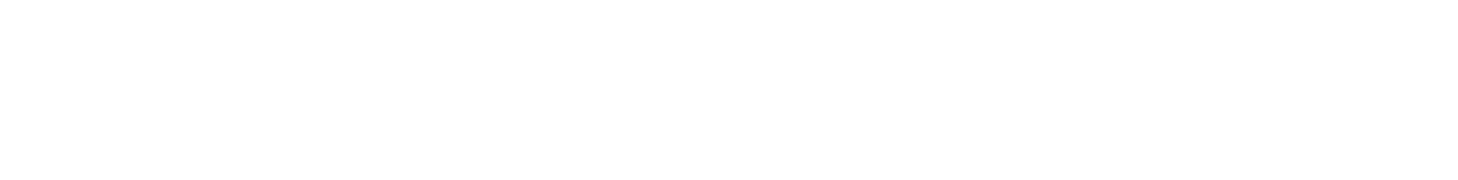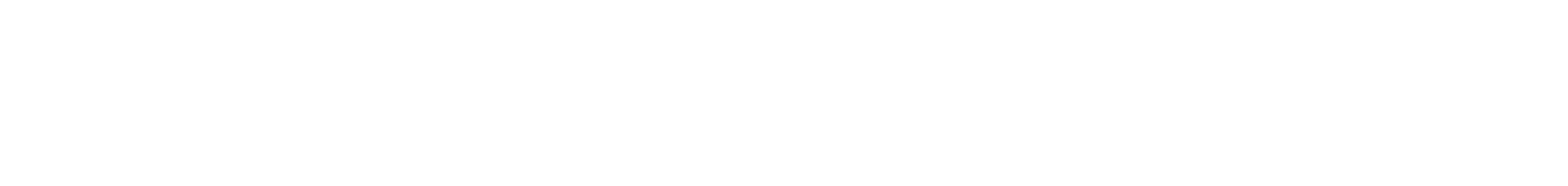Das Ersti-Gefühl wäre eventuell präsent gewesen, wenn ich für den Master in eine andere Stadt gezogen wäre. Münster stand hoch im Kurs, aber ich habe mich aus diversen Gründen dazu entschieden in Köln zu bleiben. Das habe ich auch nicht bereut. Die akademisch wichtigsten Gründe waren:
- Das Mastermodell in Köln ist sehr labororientiert
- Die Arbeitsgruppe von Frau Prof. Kath-Schorr forscht an Themenbereichen, die sich perfekt mit meinen Interessen decken
- Ich hatte Aussicht auf eine Stelle als Tutor
Viele Praktika, wenig Klausuren
Mir war es sehr wichtig, dass ich im Masterstudium vor allem praktische Erfahrungen sammmle. Während man in den fortgeschrittenen Vorlesungen häufig Themen hört, welche entweder bereits bekannt oder viel zu spezifisch sind, lernt mab im Labor und durch das Schreiben von Berichten doch meistens viel mehr und nachhaltiger. Sowohl interlektuell als auch handwerklich habe ich mir somit von einem labororientierten Master viel erhofft.Künstliche Basenpaare
Prof.'in Kath-Schorr ist noch gar nicht so lange an der Uni Köln, wird jetzt aber Stück für Stück die großen OC-Arbeitskreise ablösen. Besonders prominent waren der AK Berkessel und der AK Schmalz, bei welchem ich noch meine Bachelorarbeit absolvieren konnte. Beide Professoren befinden sich aber nun im Ruhestand und hinterließen viele Labore für ihre Nachfolgerin.Der AK Kath-Schorr forscht - ganz allgemein - gesagt an RNA. Die Arbeit ist daraus motiviert, dass bisher noch nicht all zu viele RNA-Strukturen vollständig aufgedeckt worden sind. Dies liegt vor allem daran, dass RNA eine ganze Menge möglicher intramolekularer Wechselwirkungen eingehen kann - weitaus mehr als es Proteine können. Die Sekundär- und Tertiärstrukturen von RNA sind dementsprechend Komplex und nur schwer vorherzusagen.
Um verschiedene RNA´s nun möglichst gut in vitro strukturell zu erforschen, kann man Peilsender an beide Enden der RNA anbringen. Dann lässt man die RNA ihre natürliche Konfiguration einnehmen, misst den Abstand zwischen beiden Peilsendern, und kann dann vergleichen, ob dieser Abstand zum vorhergesagten Abstand passt. Die Vorhersagen werden im vorhinein durch Programme berechnet.
Diese Peilsender sind sogenannte Spinmarker. Es handelt sich um Strukturen, mit stabilen ungepaarten Elektronen. Das TEMPO-Radikal kann beispielsweise als Spinmarker eingebaut werden in Moleküle. Mittels Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (kurz EPR-Spektroskopie) kann man dann selektiv diese ungepaarten Elektronen untersuchen und durch deren Wechselwirkung durch den Raum dann ihren Abstand ermitteln.
Doch wie bringt man Spinmarker an RNA an? Es ist tatsächlich keine triviale Aufgabe, Spinmarkermoleküle an RNA anzubringen, ohne die RNA-Struktur dabei vollständig zu verzerren. Eine Lösung hierfür sind künstliche Basenpaare.
Unter künstlichen Basenpaaren versteht man unnatürliche Moleküke, welche sich wie natürliche Basenpaare in RNA einbauen lassen, und dort auch ähnliche Wechselwirkungen mit sich und ihrer Umgebung ausüben. Sie sollen sich also möglichst natürlich verhalten, aber im Idealfall auch so modifiziert oder weiterentwickelt werden können, dass man speziellen Nutzen aus ihnen ziehen kann. In diesem Fall wäre ein Nutzen, dass wir eine Andockstation für Spinmarker an ihnen anbringen. Mit Hilfe von Click-Chemie lassen sich so Spinmarker an vordefinierten Stellen in der RNA einfügen.
 X und Y sind in diesem Bild unsere künstlichen Basenpaare. Sie werden zuerst in DNA eingebaut. Dann wird die DNA in RNA transkribiert. Nun können wir unseren Spinmarker an die designierten Bindestellen binden lassen.
X und Y sind in diesem Bild unsere künstlichen Basenpaare. Sie werden zuerst in DNA eingebaut. Dann wird die DNA in RNA transkribiert. Nun können wir unseren Spinmarker an die designierten Bindestellen binden lassen.
Über dieses Thema mache ich in naher Zukunft vermutlich einen eigenen Artikel oder ein eigenes Video. Künstliche Basenpaare sind nämlich nicht nur für die strukturelle Untersuchung von RNA interessant, sondern mit ihr lassen sich auch künstliche Aminosäuren in Proteinen einbauen. Man kann somit semi-synthetische Organismen herstellen beispielsweise.
Nun auch offline Tutor
Seit diesem Semester bin ich jetzt auch Tutor für organische Chemie an meiner Uni. Das ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, da ich mir diese Stelle schon seit drei Jahren gewünscht habe. Wissensvermittlung ist es einfach für mich, und durch das Wiederholen und Erklären von OC-Themen vertieft man auch immer das eigene Verständnis. Und nach einem Semester Tutortätigkeit kann ich sagen: Es ist wirklich so erfüllend, wie ich es mir vorgestellt habe. 😊Mentale Gesundheit
Ich habe es besser geschafft, auf meine mentale Gesundheit zu achten in diesem Semester. Konkret konnte ich unter anderem verbessern, dass ich bewusst Arbeit und Freizeit trenne und auch bei meinen Mitmenschen auf das Thema aufmerksam gemacht habe. Glücklicherweise findet das Thema Mental Health auch im Chemiestudium immer mehr Aufmerksamkeit - zu recht.Aussicht Wintersemester
Im kommenden Wintersemester habe ich (eventuell) eine ganz neue Aufgabe vor mir: Ich bin im Bundesvorstand des Jungchemiker Forums. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, aber erstmal muss ich noch gewählt werden. Das passiert hoffentlich morgen (30.09.) in Karlsruhe. Jetzt grade befinde ich mich auch im Zug dorthin. Wenn ich gewählt werde, bin ich der Webmaster des JCF´s für mindestens ein Jahr. Nun macht sich bezahlt, dass ich diese Website damals selbst auf die Beine gestellt habe 🙂Abgesehen davon habe ich einige Videoideen, die ich dieses Jahr noch umsetzen will. So stay tuned.
Cheers André 💙