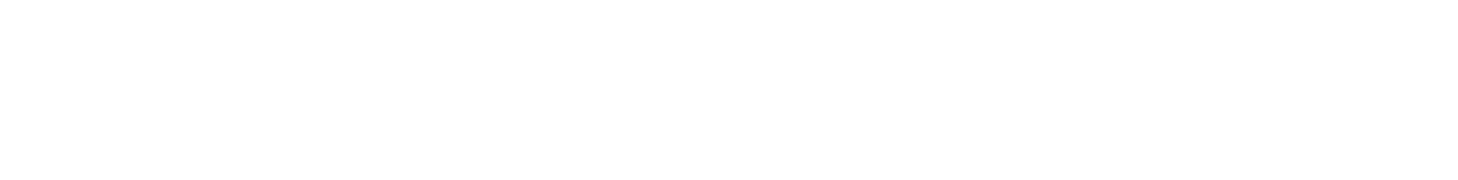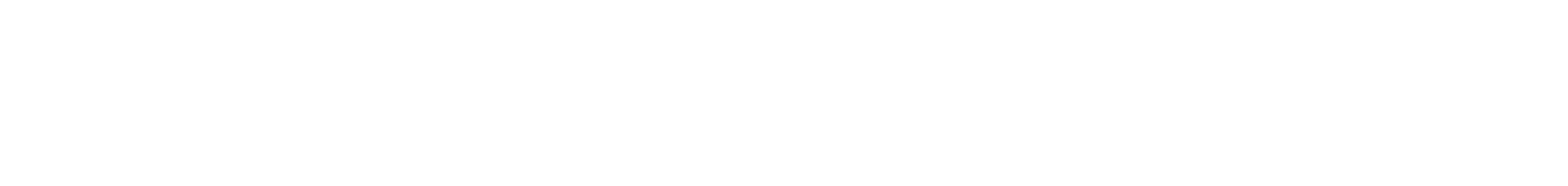Neben den induktiven Effekt und dem mesomeren Effekt gibt es eine dritte, wichtige Art wie Reste Ladungen, Radikale oder π-Bindungen stabilisieren bzw. destabilisieren können – und zwar über Hyperkonjugation. Der Effekt der Hyperkonjugation ist hierbei im Allgemeinen schwächer als der mesomere Effekt, aber meistens deutlich relevanter als induktive Effekte.
Neben den induktiven Effekt und dem mesomeren Effekt gibt es eine dritte, wichtige Art wie Reste Ladungen, Radikale oder π-Bindungen stabilisieren bzw. destabilisieren können – und zwar über Hyperkonjugation. Der Effekt der Hyperkonjugation ist hierbei im Allgemeinen schwächer als der mesomere Effekt, aber meistens deutlich relevanter als induktive Effekte.Wenngleich es sich bei der Hyperkonjugation um kein gruppen- oder elementspezifisches Phänomen handelt, fokussieren wir uns im Folgenden auf die Hyperkonjugation, welche von C-C- oder C-H-Bindungen von Alkylresten ausgeht. Diese ist am relevantesten für den Einstieg in die organische Chemie. Es sollte aber im Hinterkopf behalten werden, dass es sich bei Hyperkonjugation um ein allgemeines Prinzip handelt, und in verschiedenen Formen in der organischen Chemie vorkommt; wie beispielweise beim anomeren Effekt.
Stabilität von Carbokationen
Schon früh lernt man, dass ein Carbokation umso stabiler ist, je mehr Alkylsubstituenten der Kohlenstoff trägt: Als Erklärung hierfür, wird oft der +I-Effekt der Alkylsubstituenten genannt. Dieser ist jedoch in Wahrheit nicht ausschlaggebend für die Stabilität von Carbokationen – viel entscheidender ist die Hyperkonjugation, welche die positive Ladung kompensiert, indem Elektronendichte aus der benachbarten σC-H-Bindung (also der C-H-Einfachbindung) in das leere p-Orbital gespendet wird. Je mehr benachbarte C-H-Bindungen wir haben, desto mehr Elektronendichte wird durchschnittlich in die Elektronenlücke gespendet, und desto besser wird die positive Formalladung kompensiert. Deshalb sind tertiäre Carbokationen
(3x Hyperkonjugation durch die Alkylreste) stabiler als primäre Carbokationen
(1x Hyperkonjugation durch einen Alkylrest).
Als Erklärung hierfür, wird oft der +I-Effekt der Alkylsubstituenten genannt. Dieser ist jedoch in Wahrheit nicht ausschlaggebend für die Stabilität von Carbokationen – viel entscheidender ist die Hyperkonjugation, welche die positive Ladung kompensiert, indem Elektronendichte aus der benachbarten σC-H-Bindung (also der C-H-Einfachbindung) in das leere p-Orbital gespendet wird. Je mehr benachbarte C-H-Bindungen wir haben, desto mehr Elektronendichte wird durchschnittlich in die Elektronenlücke gespendet, und desto besser wird die positive Formalladung kompensiert. Deshalb sind tertiäre Carbokationen
(3x Hyperkonjugation durch die Alkylreste) stabiler als primäre Carbokationen
(1x Hyperkonjugation durch einen Alkylrest).
 Wie das im Detail aussieht, schauen wir uns im folgenden Abschnitt an. Schonmal vor ab: Wir gehen der Einfachheit halber im Folgenden immer davon aus, dass die Elektronendichte aus einer C-H-Orbital stammt. Das geht aber auch mit C-C-Bindungen und es gelten dieselben Prinzipien, wie bei C-H-Bindungen.
Wie das im Detail aussieht, schauen wir uns im folgenden Abschnitt an. Schonmal vor ab: Wir gehen der Einfachheit halber im Folgenden immer davon aus, dass die Elektronendichte aus einer C-H-Orbital stammt. Das geht aber auch mit C-C-Bindungen und es gelten dieselben Prinzipien, wie bei C-H-Bindungen.
Orbital-Wechselwirkungen
Wir kommen bei Hyperkonjugation leider nicht drumherum, uns Orbital-Wechselwirkungen anzuschauen. Wir beginnen bei den Basics und schauen uns die Wechselwirkungen anhand eines Ethylkations an. Wir machen uns klar, dass der Kohlenstoff mit der positiven Ladung sp2 hybridisiert ist. Dies wird gleich noch wichtig. Für die Orbitalwechselwirkung denken wir uns alle Wasserstoffe weg, die nicht in der Bildschirmebene liegen.
Wir machen uns klar, dass der Kohlenstoff mit der positiven Ladung sp2 hybridisiert ist. Dies wird gleich noch wichtig. Für die Orbitalwechselwirkung denken wir uns alle Wasserstoffe weg, die nicht in der Bildschirmebene liegen.
 Da der positiv geladene Kohenstoff sp2 hybridisiert ist, besitzt er eine trigonal planare Geometrie. Folglich steht das leere p-Orbital senkrecht in der Bildschirmebene.
Da der positiv geladene Kohenstoff sp2 hybridisiert ist, besitzt er eine trigonal planare Geometrie. Folglich steht das leere p-Orbital senkrecht in der Bildschirmebene.
 Jetzt zeichnen wir noch die σC-H-Bindung ein. Sie besteht aus dem sp3-Orbital des Kohlenstoffs und dem 1s-Orbital des Wasserstoffs, welche durch Überlappung das zweifach besetzte σC-H-Orbital bilden.
Jetzt zeichnen wir noch die σC-H-Bindung ein. Sie besteht aus dem sp3-Orbital des Kohlenstoffs und dem 1s-Orbital des Wasserstoffs, welche durch Überlappung das zweifach besetzte σC-H-Orbital bilden.
 Nun haben wir folgende Situation: Wir haben ein besetztes Orbital (σC-H) neben einem unbesetzten p-Orbital vorliegen. Beide Orbitale liegen in der Bildschirmebene und können jetzt wunderbar wechselwirken. Hierbei fließt Elektronendichte von der C-H-Einfachbindung in das leere p-Orbital, in welchem die positive Ladung „sitzt“.
Nun haben wir folgende Situation: Wir haben ein besetztes Orbital (σC-H) neben einem unbesetzten p-Orbital vorliegen. Beide Orbitale liegen in der Bildschirmebene und können jetzt wunderbar wechselwirken. Hierbei fließt Elektronendichte von der C-H-Einfachbindung in das leere p-Orbital, in welchem die positive Ladung „sitzt“.
 Wir erhalten somit eine zusätzliche Delokalisation von Elektronen, da wir Elektronendichte verteilen. Wenn Du dir das mit Orbitalwechselwirkungen nicht so gut vorstellen kannst, kann Hyperkonjugation auch überspitzt durch sogenannte no-bond Resonanzstrukturen verdeutlich werden. Aber Achtung: Das ist ein ungeeignetes Konzept für Einsteiger und vor allem wenn es in Deiner Vorlesung nicht behandelt wurde, solltest Du sie nicht hinzeichnen. Sie helfen aber dabei zu verdeutlichen, warum Hyperkonjugation zu einer Delokalisation von Elektronen führt.
Wir erhalten somit eine zusätzliche Delokalisation von Elektronen, da wir Elektronendichte verteilen. Wenn Du dir das mit Orbitalwechselwirkungen nicht so gut vorstellen kannst, kann Hyperkonjugation auch überspitzt durch sogenannte no-bond Resonanzstrukturen verdeutlich werden. Aber Achtung: Das ist ein ungeeignetes Konzept für Einsteiger und vor allem wenn es in Deiner Vorlesung nicht behandelt wurde, solltest Du sie nicht hinzeichnen. Sie helfen aber dabei zu verdeutlichen, warum Hyperkonjugation zu einer Delokalisation von Elektronen führt.
 Da Hyperkonjugation aber nicht ansatzweise so stark ist, wie der „richtige“ mesomere Effekt, haben die No-bond Resonanzstrukturen kaum Anteil an der Realität und stellen somit absolute Extremfälle dar, und sollten deshalb auch nicht wie die normalen Resonanzstrukturen behandelt werden. Wir bleiben also bei dieser Schreibweise, welche dasselbe verdeutlicht:
Da Hyperkonjugation aber nicht ansatzweise so stark ist, wie der „richtige“ mesomere Effekt, haben die No-bond Resonanzstrukturen kaum Anteil an der Realität und stellen somit absolute Extremfälle dar, und sollten deshalb auch nicht wie die normalen Resonanzstrukturen behandelt werden. Wir bleiben also bei dieser Schreibweise, welche dasselbe verdeutlicht:

Energiediagramm der Hyperkonjugation
Zu jeder Orbitalwechselwirkung gehört auch ein Energiediagramm. Wir zeichnen also zuerst die beiden Orbitale hin, welche wechselwirken: das σC-H-Orbital und das leere p-Orbital. Das bindende σC-H-Orbital liegt hierbei energetisch tiefer als das leere p-Orbital. Jetzt zeichnen wir die Wechselwirkung zwischen beiden Orbitalen hin:
Jetzt zeichnen wir die Wechselwirkung zwischen beiden Orbitalen hin:
 Es wird ersichtlich, dass das Elektronenpaar der σC-H-Bindung abgesenkt wird. Hier sehen wir also konkret, dass Hyperkonjugation mit einem Carbokation zu einem Energiegewinn führt. Was passiert jetzt, wenn wir kein Carbokation haben, sondern ein Radikal?
Es wird ersichtlich, dass das Elektronenpaar der σC-H-Bindung abgesenkt wird. Hier sehen wir also konkret, dass Hyperkonjugation mit einem Carbokation zu einem Energiegewinn führt. Was passiert jetzt, wenn wir kein Carbokation haben, sondern ein Radikal?
Hyperkonjugation an Radikalen
Da Hyperkonjugation ein elektronen-schiebender Effekt ist, sollte es nun nicht schwer nachzuvollziehen sein, dass Radikale auch durch Hyperkonjugation stabilisiert werden.Es gelten alle Argumente wie bei Carbokationen, es fehlen uns hierbei aber nur ein Elektron, anstatt zwei Elektronen: Die benachbarte C-H oder C-C-Bindung schiebt Elektronendichte in das einfach besetzte p-Orbital des Kohlenstoffradikals. Hierdurch wird der Mangel ausgeglichen und eine zusätzliche Delokalisation erreicht.
 Auch hier gilt: Je mehr Alkylsubstituenten wir habe, desto mehr Elektronendichte wird in das halbbesetzte Orbital gespendet. Deshalb sind tertiäre Kohlenstoffradikale stabiler als sekundäre und primäre Kohlenstoffradikale.
Auch hier gilt: Je mehr Alkylsubstituenten wir habe, desto mehr Elektronendichte wird in das halbbesetzte Orbital gespendet. Deshalb sind tertiäre Kohlenstoffradikale stabiler als sekundäre und primäre Kohlenstoffradikale.
 Die Orbitalwechselwirkung sieht auch fast identisch aus, nur dass wir anstelle eines leeren p-Orbitals ein einfach besetztes p-Orbital haben.
Die Orbitalwechselwirkung sieht auch fast identisch aus, nur dass wir anstelle eines leeren p-Orbitals ein einfach besetztes p-Orbital haben.
 Im Energiediagramm sehen wir, dass wir zwar das Elektron des einfach besetzten p-Orbitals energetisch anheben, aber gleichzeitig die zwei Elektronen der C-H-Bindung energetisch abgesenkt werden. In Summe haben wir immer noch ein Äquivalent Energiegewinn.
Im Energiediagramm sehen wir, dass wir zwar das Elektron des einfach besetzten p-Orbitals energetisch anheben, aber gleichzeitig die zwei Elektronen der C-H-Bindung energetisch abgesenkt werden. In Summe haben wir immer noch ein Äquivalent Energiegewinn.

Hyperkonjugation an Carbanionen
Carbanionen können nicht stabilisiert werden durch Hyperkonjugation, da sie nur dadurch stabilisiert werden, indem eine Gruppe die Elektronen akzeptiert. Hyperkonjugation spendet jedoch Elektronen. Dass dies nicht zu einer Stabilisierung führt, lässt sich schnell an einem Energiediagramm zeigen: Die beiden Elektronen der C-H-Bindung werden abgesenkt und liefern einen Energiegewinn. Gleichzeitig werden aber die beiden Elektronen des Carbanions angehoben, was zu einer Destabilisierung führt. Folglich haben wir netto keine Stabilisierung – im Gegenteil: Als Faustregel kann man sagen, dass in einem solchen Fall die Destabilisierung immer ein bisschen größer ist als die Stabilisierung, da die Elektronen sich bei der Wechselwirkung abstoßen. Folglich werden negative Ladungen durch Hyperkonjugation sogar destabilisiert. Dies erklärt unter anderem auch die hohe Basizität von t-BuLi.
Die beiden Elektronen der C-H-Bindung werden abgesenkt und liefern einen Energiegewinn. Gleichzeitig werden aber die beiden Elektronen des Carbanions angehoben, was zu einer Destabilisierung führt. Folglich haben wir netto keine Stabilisierung – im Gegenteil: Als Faustregel kann man sagen, dass in einem solchen Fall die Destabilisierung immer ein bisschen größer ist als die Stabilisierung, da die Elektronen sich bei der Wechselwirkung abstoßen. Folglich werden negative Ladungen durch Hyperkonjugation sogar destabilisiert. Dies erklärt unter anderem auch die hohe Basizität von t-BuLi.

Hyperkonjugation an Doppelbindungen
Hyperkonjugation ist auch der Grund dafür, dass Alkene umso stabiler sind, je mehr Substituenten sie tragen. Dies liegt daran, dass die C-H- oder C-C-Bindungen in alpha-Position zur C-C-Bindung Elektronendichte in das antibindene π-Orbital der Doppelbindung spenden können. Das, was vorher leere oder halbbesetzte p-Orbitale waren, sind in diesem Fall einfach unbesetzte
π*C-C-Orbitale.
Dies liegt daran, dass die C-H- oder C-C-Bindungen in alpha-Position zur C-C-Bindung Elektronendichte in das antibindene π-Orbital der Doppelbindung spenden können. Das, was vorher leere oder halbbesetzte p-Orbitale waren, sind in diesem Fall einfach unbesetzte
π*C-C-Orbitale.
 Die no-bond Resonanzformeln sieht wie folgt aus:
Die no-bond Resonanzformeln sieht wie folgt aus:
 Hierdurch wird auch wieder deutlich, dass durch Hyperkonjugation eine Delokalisation von Elektronen erreicht wird.
Abschließend schauen wir uns nochmal das Energiediagramm an und erkennen, woher der Energiegewinn stammt.
Hierdurch wird auch wieder deutlich, dass durch Hyperkonjugation eine Delokalisation von Elektronen erreicht wird.
Abschließend schauen wir uns nochmal das Energiediagramm an und erkennen, woher der Energiegewinn stammt.

Auf einem Blick...
Hyperkonjugation
- Hyperkonjugation ist ein elektronen-schiebender Effekt, welcher u.a. Carbokationen, Kohlenstoffradikale und Doppelbindungen stabilisieren kann
- Es wird Elektronendichte aus einer σC-H- oder σC-C-Bindung in ein leeres oder halbbesetztes Orbital geschoben
- Bei Carbokationen wechselwirkt das leere p-Orbital, bei Kohlenstoffradikalen das halbbesetzte p-Orbital
- Doppelbindungen werden durch die Wechselwirkung mit dem π*-Orbital stabilisiert
Referenzen
1. K. Peter, C. Vollhardt, N. Schore, in Organische Chemie, Vol. 5, Wiley VCH, Weinheim, 2011.
2. A. Carey, R. Sundberg, in Advanced Organic Chemistry, Vol. 5, Springer, New York, 2007.
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abbildungen selbst angefertigt und urheberrechtlich geschützt.